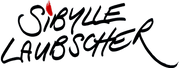Ist Kunst lehrbar? | Teil III
Ist Kunst lehrbar? | Teil III
Dem abschließenden dritten Teil dieses Essay möchte ich einen für mich überraschenden Fund voranstellen, auf den ich bei meiner Recherchearbeit traf. Es handelt sich um einen Text von Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832), welcher zu dem Beispiel Nr. 3 passt, von der Authentizität eines Künstlers:
Der Künstler müsse sich selbst immer treu bleiben!
Dass damit das kommunikative Element des Authentischen verloren geht, erklärte ich bereits, da es sich nur noch darum dreht, sich auf sich selbst zu beziehen. Wieder einmal stellte ich fest, wie modern Goethes Überlegungen wirken, weil sie aufklärerisch zu aktuellen Positionen der Kultur Stellung beziehen.
Der berühmten Aufforderung des Gottes Apoll im antiken Griechenland: „Mensch, erkenne dich selbst“, begegnete der Dichter stets mit höchster Achtung, aber auch gleichzeitig mit dem Verdacht, es handele sich dabei um die mögliche Lust einer geheim verbündeten Priesterschaft, die Menschen durch die anscheinend unerreichbare Forderung sich selbst zu erkennen, zu verwirren, sie dadurch von ihrer notwendigen Tätigkeit im Bezug zur Außenwelt abzulenken und zu einer falschen inneren Beschaulichkeit zu verführen. Punktgenau trifft Goethe damit den Selbsterfahrungswahn, welcher in unserer Alltagswelt fortwährend an uns heran getrieben und uns empfohlen wird. Er hält mit starkem Bedenken dagegen:
„Am allerfördersten aber sind unsere Nebenmenschen, welche den Vorteil haben, uns mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und daher nähere Erkenntnis von uns zu erlangen, als wir selbst es allein gewinnen mögen.
Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.„
Quelle: Goethes Farbenlehre, 1810
Goethes Gedanken sind davon geprägt, dass jeder Mensch eine individuelle Veranlagung (Dämon) besitzt, welche die Grundlage für die Entwicklung zu seiner geistigen Personalität bildet. Doch gibt er auch noch zu bedenken, dass diese Entwicklung sehr stark von zufälligen Umständen beeinflusst wird (Tyche, das Schicksal als Zufall, sowohl glücklich als auch leidvoll, zum Beispiel durch Naturgewalten, ein unvorhersehbarer Lauf des Lebens), die das subjektive Begehren (Eros) ausformen, indem sie den individuellen Lebensgang mit Notwendigkeit (Ananke = schicksalshafte Macht, z. B. die einer Gottheit) vorzeichnen. So bildet sich nach Goethes Ansicht alle menschliche Entwicklung zur Individualität immer im Wechselspiel von subjektiven Anlagen und Einwirkungen von äußeren Phänomenen. So wie wir ein- und ausatmen entwickelt sich Authentizität aus dem Wechselspiel von „Innenraum“ und „Aussenraum“, ganz genauso zwingend wie die Kunst auch.
Ich hoffe, meinen geschätzten Lesern ausreichend dargelegt zu haben, wie unsinnig und falsch es ist, von einem Künstler Authentizität einzufordern, so wie es leider üblich und unwidersprochen gemacht wird.
Auf einen mindestens ebenso oder noch weiter verbreiteten Unsinn gilt es einzugehen. Es wird behauptet, Kunst habe dann einen hohen Wert, wenn sie den Rezipienten „betroffen macht“: man fühlt sich von ihr betroffen, dann hat sie Wirksamkeit und ist von Qualität. Was jedoch genau mit Betroffenheit gemeint ist, wird in der Regel nicht erklärt. Handelt sich es um ein Gefühl, welches gedanklich verarbeitet und eingeordnet wird? Worin eingeordnet wird?
Beschäftigt man sich damit, was mit „Betroffenheit“ einmal ausgedrückt wurde, dann ist es außerordentlich überraschend zu entdecken, welchen Wurzeln dieser Begriff einstmals entsprang und man stellt fest, dass Betroffenheit in Bezug auf Kunst eine dumme und damit völlig unbrauchbare Kennzeichnung ist und deshalb zu keinem ästhetischen Urteil führt. Das möchte ich ausführlicher erklären:
Betroffenheit kennzeichnet ursprünglich im antiken Griechenland eine Sprechweise, bezüglich von Vorstellungen über das menschliche Schicksal. In dieser Zeit der Geburt der europäischen Kultur (um 600 – 400 vor Christus) unterschied man zwei Formen, in denen sich das Schicksal dem Menschen offenbarte: Tyche und Moira.
Tyche ist das Schicksal, dass Menschen erleiden, wenn ihnen persönlich plötzlich und unerwartet etwas Gutes oder Schlechtes zustößt.
Moira ist das Schicksal, dass wir mit allen Menschen gemeinsam haben, naturgegeben und unverrückbar, zum Beispiel, dass wir alle einmal sterben müssen.
Wenn wir auf der Straße von einem Auto angefahren werden, ist das nicht eine unabwendbare Notwendigkeit, die irgendwann eintritt, sondern der Zufall, dass Schicksal aus dem Alltäglichen. Beide, Tyche und Moira, machen betroffen durch Naturgegebenheit – zum Beispiel der Tod – oder dass uns etwas zustoßen kann wie ein Unfall. Und nun ganz genau: der Mensch, welcher durch Schicksale getroffen ist, also von etwas „Existenziellem“, ein tiefes Leid oder Glück erfährt, der ist in diesem Sinne ein Betroffener: es muss etwas sein, dass tief seine gesamte Existenz erschüttert oder gar verändert.
Es gibt auf der Grundlage der antiken Vorstellung im anschließenden Christentum eine Art Fortführung dieses Verständnis von Betroffenheit als eine existenziell tiefgreifende Erfahrung. Das ist in der alttestamentarischen Lehre, im zweiten Buch Moses, 33, die Erzählung von dem Wunsche Moses an Gott, dessen Herrlichkeit einmal anschauen zu dürfen. Daraus entwickelte sich die wohl bedeutendste Quelle für eine theologisch orientierte Ästhetik. Es geht um die sogenannte „Visio dei“, die Ansicht Gottes, das mittelalterliche Paradigma der Ästhetik. Doch Gott schränkt den Wunsch des Moses ein, indem er ihm erklärt, dass er sein Angesicht nicht schauen könne, denn kein Mensch würde dies ertragen und sofort sterben. Gott bietet Moses an, an ihm vorüberzugehen und dann könne er ihn von hinten anschauen, die Rückseite, wenn das Geschehen vorbei ist. Doch das Angesicht Gottes darf er niemals sehen. Also im Nachhinein, gleichsam aus der Erinnerung ergibt sich die Erfüllung der Bitte. Deshalb ist religiöse Kunst in der Regel eine Kunst des Andenkens. Übrigens nicht nur im Christentum.
Wer Gott zu Gesicht bekommt, ist betroffen und fällt tot um. In diesem richtigen Verständnis von Betroffenheit müssten diejenigen tot umfallen, die sich von Kunst betroffen fühlen. Es ist nie die Unmittelbarkeit der Begegnung entscheidend, was permanent im Vernissage-Code behauptet wird, sondern die Mittelbarkeit.
Sehr bekannt in der Literaturwissenschaft ist der Satz des Dichters August Graf von Platen (1796 – 1835) in seinem Gedicht „Tristan“:
„Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
ist dem Tode schon anheim gegeben.“
Das ist definitiv die Übernahme des biblischen Ereignisses in das literarische Kunstschaffen.
Ich könnte noch weitere Beispiele des Betroffenseins anführen, so populäre wie die von Orpheus und Eurydike und das Verbot zurück zu schauen, wenn sich beide die Unterwelt (Hades) anschauen. Eurydike hält sich nicht an das Verbot, ist betroffen und fällt tot um.
Also das Verständnis von Betroffenheit ist immer von tiefster existenzieller Bedeutung erfüllt! Es bedeutet immer etwas Grundhaftes auch und vor allem, wenn man von Betroffenheit spricht im Zusammenhang mit einem Kunstwerk. Doch heute ist es chic von Betroffenheit zu reden, da es so etwas wie Sensibilität zeigen soll und ist so ganz besonders im kulturellen Geschwätz permanent präsent. Mit einem ästhetischen Prozess innerhalb der Kunst hat Betroffenheit nicht das Geringste zu tun. Doch, und darauf möchte ich stark verweisen, verfügt man nicht mehr über ein stabiles Grundwissen, ist abgetrennt von einer richtig verstandenen Tradition und so bedient man sich defizitärer Kunsturteile.
Bevor ich, wie zu Beginn angekündigt, auf Textbeispiele des Kulturjournalismus eingehe, halte ich es der Sache dienlich, dass Verständnis von „Kunst“ begrifflich zu präzisieren. Dabei geht es vor allem darum, drei Begriffe voneinander zu unterscheiden: Kunst, Kunstwerk und Kultur. Diese drei werden in der Regel so verwendet, als hätten sie die gleiche Bedeutung. Daraus entsteht wahrscheinlich eine Quelle für eklatante Fehlinterpretationen innerhalb dieser verwandten Begriffe.
Was ist Kunst? Diese oft gestellte Frage kann entgegen verbreiteter Behauptung, dass man es nicht genau wissen könne, sehr präzise beantwortet werden: Kunst umfasst alles dasjenige, was nicht Natur ist. Sie ist nicht natürlich sondern künstlich, von Menschen gemacht. Kunst ist die Kultur der Menschen des Brauchbaren und Nützlichen. Deshalb ist es unsinnig, die Begriffe Kunst und Kultur jeweils getrennt zu verwenden, da beide dasselbe behaupten und identisch sind: die objektive Lebenswelt der Menschen.
Ein Kunstwerk hingegen ist etwas völlig anderes. Es ist immer eine Objektivation, die von Menschen aus ihrer objektiven Lebenswelt hervor gehoben wird in einer zweckfreien Form: als Kunstwerk. Das Kunstwerk ist immer handwerklich gemacht. Dieses Handwerk kann natürlich gelehrt werden, darüber am Schluss ausführlicher.
Zum besseren Verständnis ein Beispiel: wir bedienen uns einer objektiven Sprache, um uns gegenseitig verständigen zu können. Das ist nützlich. Eine Objektivation hingegen, die sich über diese Sprache zweckfrei empor hebt, ist beispielsweise die Form des Gedichtes. Diese Sprachform einer Objektivation steht über der objektiv alltäglichen Sprache.
Den Aufbau des auf diese Weise objektivierten Geistes (Gedicht) kann man sich in drei Schichten vorstellen:
- der eines dinglichen Trägers (Leinwand..Marmor..Dreiklang in der Musik aus Grundton, Terz und Quinte...
- und das in ihm gefasste geistige Gut (Ideen)
- lebendiger Geist im Austausch von Werk und Rezipienten.
Um es einmal im ästhetischen Verständnis deutlich zusammen zu fassen: ein Kunstwerk ist stets eine Objektivation in Form einer singulären Totalität, zweckfrei, einzigartig und eine Ganzheit. Ein Kunstwerk ist nie falsch oder richtig oder gar moralisch! Es verweist auf nichts außerhalb seiner selbst und ist in dieser Selbstreferenzialität unendlich deutbar.
Für diejenigen, welche diese Überlegungen vertiefen möchten, empfehle ich eine Rede des Religionsphilosophien Romano Guardini (1895 – 1965), welche dieser anlässlich der Wiedereröffnung der Stuttgarter Akademie der bildenden Künste, 1947 hielt: „Über das Wesen des Kunstwerkes“ (als Buch erhältlich). Oder auch Martin Heideggers Schrift: „Der Ursprung des Kunstwerkes“ (Reclam, Nr. 8446, 1960) Achtung: beiden Gelehrten geht es um das „Kunstwerk“ und nicht um die Kunst!
Ein Nachweis für das ungenügende Wissen und Verständnis von Kunst und Kultur ist die gängige Installierung eines „Ministerium für Kunst und Kultur“. Die Trennung der Begriffe ist unsinnig. Ein „Ministerium der Künste“ wäre richtig.
Nun zum Kunstjournalismus und hier zuerst zu dem Beitrag von Peter Meyer, mit dem Titel „Kunst und Bedeutung“, in der NZZ vom 26. März 2005. Im Vergleich zu dem inhaltlichen Niveau ähnlicher Beiträge der darauf folgenden Jahre bietet Meyer hervorragende Qualität, vor allem aus seinem sicheren Grundwissen, die so nie wieder in der NZZ erreicht wurde. Das mag wohl auch der Grund dafür sein, dass sein Text heute immer noch im Internet abrufbar blieb. Ganz zu recht!
Dennoch treten auch in seiner Darlegungen Unschärfen auf. Zu einer möchte ich an dieser Stelle erklärende Überlegungen anbieten.
Schon das Thema seines Beitrages ist falsch gestellt, denn es geht ihm gar nicht um die Kunst, sondern um das Kunstwerk. Sein Titel müsste richtig lauten: „Kunstwerk und Bedeutung“. Im Untertitel dann: „Gedanken zur aktuellen Diskussion über Kunst“, müsste dementsprechend durch Kunstwerk ersetzt werden.
Zu einem Textabschnitt: „Kunst und Bedeutung“ möchte ich folgendes kommentieren:
Meyer schreibt: „Kunst muss eine Aussage haben. Dies ist die Überzeugung, die falsch oder einseitig verstanden zu der Entwertung des Ästhetischen geführt hat, die wir gegenwärtig erleben. Der Ausdruck „Aussage“ im Zusammenhang mit Kunst ist aus mehreren Gründen problematisch, schon allein deshalb, weil man Aussagen eigentlich gar nicht haben, sondern nur machen kann, besonders aber weil er für zwei verschiedene Dinge herhalten muss, die oft verwechselt und vermengt werden. In der präzisen Lesart bezeichnet er etwas im Kunstwerk, was ins Rationale beziehungsweise in die Sprache der realen Welt übersetzbar ist und was kritisch, in manchen Fällen belehrend bis missionarisch, in diese reale Welt hinüber wirken soll.“
Zu fordern, ein Kunstwerk müsse eine Aussage haben, ist falsch. Da hat Meyer vollkommen recht. Dazu bringt er später das Beispiel aus dem Kunstunterricht in der Schule, wenn der Lehrer die Schüler fragt: „Was will der Künstler uns sagen?“ Gar nichts! Diese Frage ist der Sündenfall der Ästhetik.
Dies ist alles richtig vorgetragen, aber dennoch unzureichend, denn jedes Kunstwerk hat eben auch einen expressiven kommunikativen Charakter, welcher sich nicht aus seiner Bedeutung ergibt, da hat Meyer wieder recht, sondern aus seiner Deutbarkeit. Zwar bedeutet das Werk nicht etwas aus sich selbst heraus oder ist nur in einer Bedeutung gefangen, aber es ist immer an einen Rezipienten gerichtet, ja sogar angewiesen auf den Dialog mit ihm. So ist das Werk im Kantischen Sinne konsubjektiv, zusammen verbunden mit dem Rezipienten. Seine Deutbarkeit ergibt sich aus seiner Offenheit, ein freier Zeichenkomplex mit vielen Leerstellen. Diese Leerstellen, also dort, wo ich im Moment selbst gerne sein möchte, sind es, die wir beim rezipieren füllen müssen und dem Kunstwerk durch diese tätige Hinwendung seine eigentliche Bedeutung geben. Dieses Gespräch mit dem Werk verleiht ihm seine Bedeutung. Dadurch, dass man es betrachtet, anhört, dass man es liest und man von ihm in einem Augenblick erfasst wird, erfüllt sich der ästhetische Augenblick. Also: zu einem Kunstwerk gehört immer auch seine Expressivität, seine Darstellungsform und zeichenhafte Repräsentanz in einem Material. Auch wenn modern gern gesagt wird, es handelt sich um ein stilles oder stummes Kunstwerk, dass genau nichts ausdrücken soll, muss dennoch diese Stummheit künstlerisch zum Ausdruck gebracht werden und zeigen, wie das Schweigen aussieht! Zu behaupten, ich sehe alles in mir, ich kann es aber nicht ausdrücken, es ist so ein mystischer Zustand (sehr modern), den man nicht anschauen und ausdrücken kann, ist unzureichend. Die „klare Tiefe“ (G. F. Wilhelm Hegel, 1770 - 1831) ist immer vermittelbar und zwar rational. Die „trübe Tiefe“ (Hegel) natürlich nicht. („Die Phänomenologie des Geistes“) Ein Kunstwerk verlangt jedoch immer Klarheit.
„Die Pflicht, das Geschwätz zurück zu halten, ist eine wesentliche Bedingung für jede Bildung.“ (Hegel: „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“)
Man könnte auch statt „Bedeutung“ von einer sogenannten „Erfüllungsgestalt“ des Kunstwerkes sprechen und dessen Glücksmöglichkeiten für den Rezipienten, welche alles Anreißerische, provokativ Nötigende und Highlightsgetöse des Dialoges vertreiben.
Trotz dieser feinen aber wichtigen Korrektur, möchte ich noch einmal betonen, dass die gesamte Abhandlung von Peter Meyer qualitativ sehr wertvoll ist und einen Journalismus präsentiert, welchen man heute in den Feuilletons der Zeitungen kaum noch antrifft.
Darüber, um eine Einschätzung zu geben, wähle ich einen Text von Gerhard Mack, einer der Nachfolger von Meyer in der NZZ Kulturredaktion. Ich erwähnte ihn schon im Teil II dieses Feuilletons bezüglich seiner falschen Verwendung des Begriffes „Gegenwart“. Mack verkörpert genau den Vertreter eines oberflächlichen, defizitären Kulturjournalismus unserer Tage: stets gut informiert, jedoch von mangelhaftem gesicherten Grundwissen. Damit ist gemeint, dass er die Formen nicht kennt, denen er seine Informationen richtig passend zuordnen kann und zuordnen müsste!
In seinem Beitrag der NZZ vom 19. Januar 2025 „Ist das Kunst?“ schreibt er:
„Auch wenn sich in unseren hoch individualisierten liberalen Gesellschaften also kaum verbindlich sagen lässt, was als Kunst gilt und was nicht, darf man doch insgesamt festhalten: wenn Kunst interessant sein soll, hat sie mit Freiheit zu tun, mit der Überschreitung von Grenzen, die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen.“
Er fällt eine total falsche Behauptung, wie man dem von mir bereits Erklärtem entnehmen kann: wir können nämlich verbindlich sagen, was Kunst ist, allerdings nicht, was ein Kunstwerk zu einem Kunstwerk macht. Diesen feinen philosophischen Unterschied kennt Mack anscheinend nicht. Wenn Kunst interessant sein soll, dann trifft er eine völlig falsche Auslegung von Kunst. Wenn Kunst, richtiger gesagt, ein Kunstwerk, interessant sein soll, dann verfolgt es einen Zweck und ist deshalb niemals ein Kunstwerk. Außerdem hat ein Kunstwerk nichts mit „Freiheit zu tun“ sondern ist stets Freiheit. Ihr höchstes Gut ist der Mensch selbst!
Ein Beispiel für Kulturgeschwätz greife ich aus seinem Text: „… immer geht es um Öffnung der Wahrnehmung.“ Meine Frage, wie soll das vollzogen werden? Der Wahrnehmung ist Offenheit stets immanent. Ihr wohnt Offenheit inne und kann ihr nicht von Aussen hinzugefügt werden. Er schreibt weiter: „… es geht um Vermehrung des Darstellbaren und Sagbaren.“ Darstellbar ist prinzipiell alles, beziehungsweise das Darstellbare gibt es nicht. Ebenso ist stets alles sagbar, beziehungsweise das Sagbare gibt es nicht.
Ich glaube diese wenigen Beispiele des Unsinns reichen, um nachzuweisen, wie dümmlich derartige Texte sind. Doch es gibt tatsächliche noch Steigerungen dieser defizitären Inhalte. In der NZZ vom 16. März 2025 mit der Überschrift „Highlights aus Kunst und Kultur“, worauf ich schon zu Beginn meiner Ausführung hinwies. Ich möchte nur in Kürze darauf eingehen, weil sich dieser Text „Ein Hoch auf den Fehler“ überhaupt nicht mit Kunst oder genauer gefasst mit dem Kunstwerk beschäftigt. Im Mittelpunkt steht das Schaffen von Claudia Caviezel, die sich als eine Schweizer Textilkünstlerin bezeichnet. „Sie sprengt jeden Rahmen“, wird postuliert, um daran anschließend die Hälfte des Artikels über Produktdesign und deren Verkäufe in verschiedenen Firmen, die tatsächlich auch namentlich noch genannt werden, zu resonieren. Sie ist Trägerin des „Schweizerischen Grand Prix für Design“ und ihre Erzeugnisse werden im Kunsthaus St. Gallen groß präsentiert: „… diese nehmen bei näherer Betrachtung den Schwung des schmiedeeisernen Treppengeländers des Kunstmuseums auf. “Glitch“ verbindet so gutschweizerische alte Schmiedekunst visuell mit lateinamerikanischen Textiltechniken und erhebt diese Kombination durch moderne digitale Mittel zu einem überraschend eigenständigen Sinneserlebnis. … Der wild-bunte Teppich wirft aber auch Fragen zum Status der Unschärfe zwischen Technik, künstlicher Intelligenz, und menschlicher Kreativität auf…“ Ist so etwas zu verstehen?
Es geht scheinbar um KI (= maschinelle Datenverarbeitung) und menschlicher Kreativität. Zum Verständnis von menschlicher Kreativität hatte ich mich bereits ausführlich geäußert, sodass sich daraus der Leser selbst ein Urteil bilden kann.
Die Autorin dieses Artikels, Silvia Tschui, verspricht in der Titelüberschrift: „Grundlegende Fragen zur Kreativität in Zeiten künstlicher Intelligenz zu erörtern“… und findet „eine triumphale Antwort.“ In ihrem Text findet sich davon allerdings fast nichts. Stattdessen wird locker über den Begriff „Glitsh“ unappetitlich flaniert.
Abschließend möchte ich noch einmal auf mein Thema zurück kommen „Ist Kunst lehrbar?“ Ich habe diese Frage sicher nicht völlig ausreichend, aber dennoch versucht, fundiert zu beantworten und hoffentlich auch Anregungen zum eigenen Nachdenken geben können.
Einen großen Meister möchte ich noch zu Wort kommen lassen, den Maler Auguste Renoir (1841 - 1919). Er blieb sein ganzes Leben der Verbindung von Handwerk und Ideal treu. In einem Brief aus dem Jahre 1911 schreibt er: „… welche Bedeutung man auch immer den Nebengründen beim Verfall unsere Handwerke beimessen will, der Hauptgrund ist meiner Meinung nach das Fehlen jeglichen Ideals. Die geschickteste Hand ist immer nur die Dienerin des Gedankens. Deshalb befürchte ich auch, dass alle Versuche, uns die alten Kunsthandwerker wieder zu geben, nutzlos sind. Selbst wenn es möglich sein sollte, in unseren Berufsschulen geschickte Arbeiter heranzubilden, die die Technik ihres Handwerks vollkommen beherrschen, so wird mit ihnen nicht viel anzufangen sein, wenn sie kein Ideal besitzen, das ihnen als Maßstab für ihre Arbeit dient… die Malerei ist ein Handwerk wie die Tischlerei oder die Schmiedekunst, sie folgt denselben Regeln…“
Begann ich mit Gedanken von Johann Wolfgang Goethe, so möchte ich mit ihm diesen Essay auch beschließen.
Goethe: „In der wahren Kunst gibt es keine Vorschule, wohl aber Vorbereitungen; die Beste jedoch ist die Teilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind treffliche Maler hervorgegangen.
Aller Kunst muss das Handwerk vorausgehen.“
© Martin Rabe & Sibylle Laubscher
Weitere Texte
-
![Vibrations of being: The Art of Resonant Spaces]()
![Vibrations of being: The Art of Resonant Spaces]()
Vibrations of being: The Art of Resonant Spaces
-
![Ansprache an der Ausstellung zur Frauenfussball EM in Sion, Schwiez, 2025]()
![Ansprache an der Ausstellung zur Frauenfussball EM in Sion, Schwiez, 2025]()
Ansprache an der Ausstellung zur Frauenfussball EM in Sion, Schwiez, 2025
-
![Speech opening the art exhibition celebrating the Women's Football Championships, Switzerland 2025]()
![Speech opening the art exhibition celebrating the Women's Football Championships, Switzerland 2025]()
Speech opening the art exhibition celebrating the Women's Football Championships, Switzerland 2025
-
![Ist Kunst lehrbar? Teil I]()
![Ist Kunst lehrbar? Teil I]()
Ist Kunst lehrbar? Teil I
-
![Ist Kunst lehrbar? Teil II]()
![Ist Kunst lehrbar? Teil II]()
Ist Kunst lehrbar? Teil II
-
![Can Art be taught?]()
![Can Art be taught?]()
Can Art be taught?
-
![Ist Kunst lehrbar? | Teil III]()
![Ist Kunst lehrbar? | Teil III]()
Ist Kunst lehrbar? | Teil III
-
![Can Art be taught | Part III]()
![Can Art be taught | Part III]()
Can Art be taught | Part III
-
![Statt einer Vernissagerede – ein Dialog über Kunst]()
![Statt einer Vernissagerede – ein Dialog über Kunst]()
Statt einer Vernissagerede – ein Dialog über Kunst
-
![Instead of a vernissage speech – a dialog about art]()
![Instead of a vernissage speech – a dialog about art]()
Instead of a vernissage speech – a dialog about art
-
![Schaffen Einschränkungen eingeschränkte Kunst?]()
![Schaffen Einschränkungen eingeschränkte Kunst?]()
Schaffen Einschränkungen eingeschränkte Kunst?
-
![Do restrictions create limited art?]()
![Do restrictions create limited art?]()
Do restrictions create limited art?
-
![Die Krise der Wissenschaften und der Künste]()
![Die Krise der Wissenschaften und der Künste]()
Die Krise der Wissenschaften und der Künste
-
![The crisis in science and art]()
![The crisis in science and art]()
The crisis in science and art
-
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil 1]()
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil 1]()
Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil 1
-
![Artificial Intelligence & the Absurd Part 1]()
![Artificial Intelligence & the Absurd Part 1]()
Artificial Intelligence & the Absurd Part 1
-
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil II]()
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil II]()
Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil II
-
![Artificial Intelligence & the Absurd Part II]()
![Artificial Intelligence & the Absurd Part II]()
Artificial Intelligence & the Absurd Part II
-
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil III]()
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil III]()
Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil III
-
![Artificial Intelligence & the Absurd Part III]()
![Artificial Intelligence & the Absurd Part III]()
Artificial Intelligence & the Absurd Part III
-
![Künstliche Intelligenz und das Absurde Teil IV (Schluss)]()
![Künstliche Intelligenz und das Absurde Teil IV (Schluss)]()
Künstliche Intelligenz und das Absurde Teil IV (Schluss)
-
![Artificial Intelligence and the Absurd Part IV (Conclusion)]()
![Artificial Intelligence and the Absurd Part IV (Conclusion)]()
Artificial Intelligence and the Absurd Part IV (Conclusion)
-
![Why are Americans/the Swiss afraid of Dragons? by Ursula Le Guin]()
![Why are Americans/the Swiss afraid of Dragons? by Ursula Le Guin]()
Why are Americans/the Swiss afraid of Dragons? by Ursula Le Guin
-
![Warum haben Amerikaner/Schweizer Angst vor Drachen? von Ursula Le Guin]()
![Warum haben Amerikaner/Schweizer Angst vor Drachen? von Ursula Le Guin]()
Warum haben Amerikaner/Schweizer Angst vor Drachen? von Ursula Le Guin