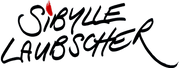Ist Kunst lehrbar? Teil II
Über die Kunst, defizitäre Kunsturteile und Kulturgeschwätz
Teil II
Im vorangegangenen ersten Teil dieses auf drei Teile angelegten Essays wies ich auf den leider zunehmend geringen Stellenwert der Kunst innerhalb unserer Gesellschaft hin. Der Hauptgrund für diese bedauernswerte Entwicklung, besteht in der fehlenden Aufklärung über die Seins- und Existenzweise von Kunst und ihrer daraus folgenden geringen Bedeutung in den Lehrplänen von Schulen und bemerkenswerter Weise leider auch in den Kunstakademien. Die Anfänge dieses Niedergangs der Kunstlehre und den Beginn eines geradezu beliebigen Umgangs mit dem Begriff und Verständnis von „Kunst“ vermuten sowohl Peter Meyer wie auch Gerhard Mack (beide Kulturjournalisten der NZZ zu unterschiedlichen Zeiten), bei Marcel Duchamp (1887 - 1968) und dessen Erfindung des „Ready-Mades.“ Diese stellte er zum ersten Mal mit der Signierung einer Pissoir Schussel 1917 auf der Ausstellung der „Society of Independent Artists“, New York, vor. Ab den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte sich daraus so etwas wie eine Anti-Haltung gegenüber den bisherigen ästhetischen Kriterien des Kunstschaffens. Eine Sicht, die rapide zunahm bis heute. Gerade deshalb wählte ich auch das Beispiel des Prospektes mit dem Zitat von Norbert Kricke, welcher Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie in den Jahren 1972 – 1981 war (siehe voriges Essay).
Es sei hier nur nebenbei darauf hingewiesen, dass man in den USA mindestens seit den „Ready-Mades“ von Duchamp nach einer eigenen, von europäischen Vorbildern losgelösten amerikanischen Kunst und Kultur suchte. Es mag zynisch klingen, aber hilfreich war in diesem Verlangen der Aderlass von europäischen Künstlern, Geisteswissenschaftlern und Naturwissenschaftlern während der Hitler-Zeit. Sehr viele von Ihnen flohen in die USA, um ihr Leben zu retten, zum Beispiel Max Beckmann, Stefan Zweig und Albert Einstein.
Der deutsche Kunstmaler und Kunstlehrer Hans Hofmann (1880 in Weißenburg, Bayern bis 1966 New York) früh ahnend, welche Schrecken kommen würden, verließ Deutschland deshalb schon 1932. Nach seiner Emigration in die USA gründete er in New York eine private Kunstschule, die er mit großem Erfolg führte. Sein Lehrangebot bestand zunächst darin, eine Synthese aus Fauvismus und Kubismus anzubieten. Schon zu Beginn zeigte er damit sein unzureichendes Kunstwollen- und Können: er lehrte „Formwandel“. Doch in der großen Kunst bedarf es jeweils eines neuen Bewusstseinswandels welches dann zu neuen Formen führen kann. Genau das war nicht sein Talent und niemand störte es.
Dennoch gelang es ihm losgelöst von der europäischen Tradition die Entwicklung eines von ihm sogenannten „abstrakten Expressionismus“. Darunter verstand er den Stil einer deutlichen Abgrenzung zum europäischen gegenständlichen Expressionismus und nannte die Werke, die nun entstanden „Action Painting“ „Art Informel“ oder „Tachismus.“ Gemeinsam ist ihnen innerhalb der abstrakten Kunst der Vorrang einer sogenannten „Aleathorik“ (Lat: Alea = der Würfel). Also eine Art von Würfelspiel, die den Zufall voranstellte für sich ergebene Farb- und Formenflüsse. Die Zufallsmethoden nannte er auch „Dripping“ oder „Frottage“, welche das malerische Geschehen bestimmten. Später traten dazu noch Äußerungen ebenfalls zufälliger Art wie „Happenings“ und „Performance“. Es sollten Weiterentwicklungen sein…
Er gilt als Künstler der ersten Generation, der sogenannten „New York School.“ Ich werde später noch einmal auf ihn zurück kommen müssen.
Wer von meinen Lesern das Verständnis der Situation der Kunst aus den USA vertiefen möchte, dem empfehle ich zwei grundlegende Abhandlungen darüber:
Jed Pearl, „New Art City“ (Hanser Verlag, 2005)
Oder Barbara Rose, „Amerikas Weg zur modernen Kunst. Von der Mülltonnenschule zu Minimal Art“ (Dumont Verlag, 1969)
Der Kariere von Hans Hofmann könnte man die Kariere von Josef Albers (1888 Bottrop, DE – 1976 New Haven, USA) an die Seite stellen, welcher die geometrische Abstraktion in Form von aneinander gereihten farbige Rechtecke pflegte und dazu Farbtheorien abfasste. Mir scheint, dass er ein viel besserer Lehrer gewesen sein mag als ein guter Künstler. Jedenfalls wurde dies sehr häufig von seinen Schülern geäußert.
Nach dem zweiten Weltkrieg hatte man gehofft, durch die Installierung der Dokumenta-Messen in Deutschland Kunstwerke von geächteten und ermordeten Künstler endlich wieder zeigen zu können. Doch bereits auf der zweiten Dokumenta 1959 bestimmten dann tatsächlich „Art-Informel“ (z. B. „Action Painting“) auf dieser Messe das Geschehen, ausgestattet mit reichlich amerikanischen Dollars und schadeten dieser eigentlich notwendigen europäischen Idee der Wiedergutmachung.
Bevor ich in meiner Thematik über die Lehre der Kunst fortfahre, scheint es mir hilfreich, noch mehr über die Bedeutung der Kunst innerhalb unserer Lebenswelt erklären zu sollen.
Sprechen wir über das Gebiet der Kunst, dann reden wir bewusst nicht über die Natur. Ist die Natur das uns vollendet Gegebene, Geschenkte, Gewachsene, dann stellt der Mensch ihr das von ihm selbst vollendet Gemachte gegenüber. Durch Kunst, durch künstliche Formen, repräsentiert der Mensch die allein von ihm gemachte Welt. Unsere Welt, unsere Kultur. Wir stellen sie der Natur voran, weil wir uns durch unsere vorwiegend geistige Personalität der Natur gegenüber überlegen fühlen. Durch unsere Fähigkeit zur Reflexion können wir unser Tun selbst beurteilen und sind nicht an vorgegebene Gesetze gebunden. In dieser Welt gibt der Mensch stets einen Spiegel seiner Selbst ab, gleichsam als die höchste Vollendung. Doch handelt es sich dabei noch lange nicht um Kunstwerke, sondern um die Fähigkeit, eine grenzenlose freie Formenvielfalt in Gegensatz der begrenzten Formenwelt der Natur zu stellen: die vom Menschen gemachten Formen sind wirklich unnatürlich und deshalb völlig frei in ihren Ausbildungen. Wir allein bestimmen ihren Inhalt und Sinn.
Befähigt werden wir dazu durch eine besondere Kraft in uns, unsere Kunstkraft, so wie die Natur über ihre eigene Naturkraft verfügt. Diese Kunstkraft äußert sich als Wille zur Formbildung. So hält Kunst das Reich der Formen, welche noch gar keinen Anschein von Kunstformen haben. Auf allen Ebenen unserer geistigen und physischen Existenz bilden wir nämlich brauchbare Formen aus, um miteinander in Freiheit und Frieden in dieser Welt leben zu können. Das sind Kommunikationsformen, Umgangsformen, geistige- und materielle Formbildungen usw.
Unsere eigene Welt errichteten wir Menschen von Beginn an aus unserer Kunstkraft und nur daraus! Das geriet leider vollkommen in Vergessenheit.
Während des Mittelalters übernahmen wir den schon in der Antike entstandene Kanon der „Sieben Freien Künste“, die einem freien Manne die notwendige Bildung verliehen.
Die Zahl sieben entstand dem Mythos, als Merkur, das Sinnbild für den menschlichen Intellekt, die Philologie, das Sinnbild für die Geisteswissenschaften, heiratete, bekamen sie die „Sieben Freien Künste“ als Brautjungfern zum Geschenk: Grammatik, Rhetorik, Dialektik (bzw. Logik), Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie.
Der sprachwissenschaftlichen Block, das sogenannte Trivium, bestand aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Das Quadrivium, bestand aus Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik.
Ab dem 13. Jahrhundert wurde in der Artisten Fakultät Naturphilosophie, Ethik und Metaphysik gelehrt.
Wir sprechen heute bereits von einem Anthropozän, indem wir Menschen nicht nur der Natur unsere Welt gegenüber stellen, sondern sogar in die Gesetzmäßigkeiten der Natur vordringen, um auf sie Einfluss zu nehmen.
Aus dieser allein uns Menschen gebildeten Kultur, die so entsteht, wie wir uns darleben, entwickelten wir auch Formen, die keinen Zweck dienten, sondern vollkommen frei vom nützlichen Wollen eine ganz andere, rein geistige Weltenschöpfung hervorbringen. Durch die freie Kunst errichten wir ein über unser Erdendasein hinausweisendes Reich, in dem wir uns heimisch und wirklich frei fühlen können. Das ist die Grundbewegung unseres Willens zum Kunstwerk. Man könnte auch sagen, unser Willen zur Freiheit. Darum geht es im Erschaffen von Kunstwerken.
Der Philosoph Martin Heidegger (1889 – 1976) spricht in diesem Zusammenhang von der „großen Kunst.“ Sie zeige uns das, was wir vorher nicht gesehen haben. Das ist die zentrale Fragestellung der Kunstphilosophie, um deren Beantwortung immer wieder neu gerungen werden muss.
In seiner Schrift „Der Ursprung des Kunstwerkes“ spricht er davon, dass die Kunst „uns das Ereignis der Wahrheit, die Wahrheit des Seienden, eröffnet.“ Dieses „Ereignis“ beinhalte die Öffnung der Welt und Offenwerden des Seins des Seienden. Die Kunst ermöglicht es uns, über das hinaus zu blicken, was wir gewohnt sind und das Wahre zu sehen, das in der Welt verborgen ist. Die Kunst ist nicht nur ein Weg, das Wahre einer Kultur auszudrücken, sondern auch das Mittel, es zu erschaffen und ein Sprungbrett zu bieten von dem aus „das, was ist“ offenbart werden kann.
Ich persönlich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als wüsste ich genau, was ein Kunstwerk ist und alle anderen wüssten es nicht. Ich plädiere für ein echtes Bemühen darum, wie ästhetische Urteile – und um die geht es nun – beschaffen sein müssen, oder vielleicht falsche Urteile sein könnten. Wenn man Urteile fällt, dann bedarf es Regeln und Kategorien, so wie ein Richter Gesetzbücher hat um zu Urteilen zu kommen, worauf ich im ersten Teil des Essays schon hinwies. Das grundhafte Wissen über Kunstwerke besteht aus einem Regelwerk, welches man kennen muss. Dies ist kein geschlossenes Regelwerk, sondern ein Regelwerk, welches immer zu Freiheit und Offenheit führen muss, denn die Kunst ist, wie wir auch, von Freiheit bestimmt.
Hierzu möchte ich ein Zitat aus dem Tagebuch des österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) vom 7. 10. 1916 anführen.
„Das Kunstwerk ist der Gegenstand sub spezie eternitatis gesehen. Also unter dem Aspekt der Unendlichkeit. Die gewöhnliche Betrachtungsweise sieht die Gegenstände gleichsam aus ihrer Mitte, die Betrachtung sub spezie eternitatis von außerhalb. So, dass sie die ganze Welt als Hintergrund haben. Kunstwerke haben also die ganze Welt als Hintergrund, das macht ihre eigentliche Bedeutung aus. Texte, Bilder oder auch Tonfolgen, die nur einen Effekt darstellen, nur eine subjektive Innerlichkeit oder ein politisches Credo zum Ausdruck bringen, diese verdienen diesen Namen nicht. Sie können zwar als historische Dokumente, als Symptome die Aufmerksamkeit verdienen, aber sie sind keine Kunstwerke.“

Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer (1528 - 29)
Öltempera of Lindentafel, 158 x 120 cm, Alte Pinakothek
Quelle: 1. Bridgeman Art Library: Objekt 8796922. Google Arts & Culture, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31568532
Der Philosoph Wittgenstein könnte dieses Bild von Altdorfer gemeint haben. Erstaunlich ist die Weite des Landschaftsbildes. Man hat sie in der Kunstgeschichte auch als " Weltlandschaft" bezeichnet. Es handelt sich um das Nildelta.Von Meisterhand ist Landschaft und Himmel rein aus der Farbe heraus zu einer überzeugenden Einheit verschnolzen.
Wittgenstein lehrt uns, dass Kunstwerke immer die ganze Welt zum Hintergrund haben müssen. Nur so etwas kann angemessen als ein Kunstwerk benannt werden. Darum geht es. Um dieses Verständnis müssen wir uns immer bemühen, genauso wie man sich um alles bemühen muss, was einem etwas bedeuten soll. Dazu bedarf es einer Lehre, welche den Charakter eines Freundes an meine Seite hat, der mich von Erlebnis zu Erlebnis führt und zum Verstehen des Erlebten bringt. Doch genau das findet seit Jahrzehnten bedauerlicherweise kaum noch statt. Stattdessen öffnet man fahrlässig das Tor für falsche, defizitäre Kunsturteile, so wie wir sie in Feuilletons, im Kunstbetrieb und leider auch im Unterricht der Schulen finden. Diese sind oftmals nichts anderes als Kulturgeschwätz: leere Urteile, die keine Bedeutung haben, abgeschnitten von der Tradition. Tradition nicht in dem Sinne, dass früher alles besser war, nicht die Asche soll gepflegt werden, sondern das Feuer erhalten bleiben. Dazu nimmt man dasjenige aus der Vergangenheit, das für uns auch heute noch bedeutungsvoll ist (z. B. das römische Recht) und verbindet es mit dem, was uns aus der Gegenwart bedeutungsvoll erscheint. Erst aus diesem Zusammenschluss entsteht die lebendige Tradition, die wir benötigen.
Ich möchte meinen bisherigen Erklärungen einige Beispiele zum besseren Verständnis hinzufügen.
Beispiel 1
Jetzt komme ich auf Hans Hofmann zurück. Von ihm stammt das sogenannte Konzept des „offenen Kunstwerkes.“ Einmal abgesehen davon, das er damit eine Binsenweisheit formuliert, denn ein Kunstwerk ist immer frei und offen für denjenigen, der sich auf es einlässt: der Betrachter bzw. Rezipient. Ohne diese immer gegebene Offenheit könnte es kein Kunstwerk sein. Doch dies meint Hofmann natürlich nicht. Für Ihn ist ein Kunstwerk das, was frei aus der Luft ergriffen und ohne einen Grund zu einem Kunstwerk erklärt wird. Beispielsweise meint Joseph Beuys (1921 - 1986) seine Kunst kann deshalb ohne weiteres zum Kunstwerk erklärt werden, weil er von der abwegigen Voraussetzung ausgeht, dass nicht nur er, sondern jeder Mensch ein Künstler sei. So etwas wird dann in den Medien vertreten und führt am Ende zu einer Art verbalisierter Ideen-Kunst, welche man gar nicht mehr herstellen muss, sondern es reicht, sie mit Worten konzeptionell zu beschreiben. Das ist natürlich Unsinn. Ein Kunstwerk will immer gemacht sein und ist an Material gebunden. Dieses Material reicht sogar bis zum instrumentellen Material wie in der Musik (Klang).
Beispiel 2
Ein defizitäres Kunsturteil, welchem man fortwährend begegnet, ist das von der „Bewusstmachung“: ein Künstler möchte mit seinem Schaffen irgendetwas bewusst machen. Er malt beispielsweise eine blumenreiche Wiese, möglichst im Großformat, um damit bewusst zu machen, dass Naturschutz wichtig ist, obwohl das längst jeder weiß. Aber er will alles noch einmal ins Bewusstsein rufen und erhellen.
Gehen wir seinem Zweck und seinem Verlangen ernsthaft nach, dann treffen wir auf eine platonische Erkenntnislehre, sie heißt Mäeutik (die Hebammen-Kunst). Es ist ein Aufklärungstopos, dass etwas bewusst werden soll, indem beispielsweise Sokrates durch Fragen etwas aus dem Menschen heraus fragt und so zum Bewusstsein führt. Das tut wahre Kunst auch: Kunst fragt durch Zeichen und Formen heraus, was im Menschen menschlich ist. Einige unserer zeitgenössischen Künstler und Autoren betreiben leider eine etwas simple Vorstellung von dieser Art der Aufklärung, die in journalistischer Manier appellativ wirken soll.
Beispiel 3
Es geht um eine sehr verbreitete falsche Sicht auf Kunstwerke: es ist die Rede vom „Authentischen.“ Der Künstler habe ein authentisches Werk geschaffen! Hier soll aus einem zufälligen Zustand oder einer Befindlichkeit des Künstlers etwas Authentisches hochgepriesen werden zu einem starken Kunstwollen und sogar zu einem Kunstwerk. Dazu muss der Künstler sich selbst treu bleiben. Das hört sich gut an! Das man damit allerdings das kommunikative Element des Authentischen ablöst ist scheinbar gleichgültig. Ich bin nämlich dann authentisch, wenn ich die Treue zum Anderen halte. Wenn man sich selbst treu bleibt, was heute populär ist, dann ist das eine falsche Verwendung des Verständnisses von Treue: man bezieht sich nur noch auf sich selbst. Diese Art von Selbsterfahrung, die niemals zu Kunst führt, ist geradezu vollkommen unmöglich, denn Kunst sucht immer das oder den Anderen. Außerdem erfahre ich niemals aus mir selbst allein, wer ich bin. Diese Selbstbezogenheit führt leider zu Isolation und Einsamkeit. Das Gegenteil von Kunst. Ich kann nur kennen lernen, wer ich bin, im Verhältnis zu anderen Menschen und zwar durch meine Taten. Authentizität als eine Art der Selbsttreue ist eine Umwertung des klassischen Verständnisses der Treue, dem Grunde nach einem hohen Gut verdünnt auf eine dürftige Selbstbeziehung. Das ist eine Verdrehung, mit der man in der Ästhetik nichts anfangen kann, aber anscheinend erfolgreich gepflegt wird.
Beispiel 4
Ein verwandtes beliebtes weiteres Beispiel „ein Künstler müsse das richtige Bewusstsein haben.“ Dann kann man ihn schätzen. Wer will das beurteilen können und wie? Hier handelt es sich um reine Gesinnungsästhetik und hat mit ästhetischen Kategorien der Kunst nichts zu tun und gehört zum allgemeinen Kulturgeschwätz.
Was unterscheidet beispielsweise das Bewusstsein eines Philosophen vom Bewusstsein eines Künstlers? Der Philosoph strebt danach Weisheit über eine gegebene Schöpfung zu gewinnen. Er widmet sich dem Gewordenen. Er sucht die Erkenntnis des absolut Realen.
Der Künstler kann nicht so vorgehen. Denn als Künstlerin muss ich erst finden, was zur Kunst gehört und was nicht! Das kann mir die Natur natürlich nicht zeigen. Insofern möchte der Künstler Bewusstsein finden über das Werdende, über das Kommende. Ich, als Künstlerin, habe ein ganz anderes Verständnis von Bewusstsein und „suche die Neuschöpfung einer konkreten Wirklichkeit, in welcher die Ideenzusammenhänge besser, vollkommener, reiner gegeben werden als in der Welt der natürlichen Anschauung.“ (Max Scheler, Schriften aus dem Nachlass, Leipzig, 1933).
Beispiel 5
Ich möchte Ihnen ein weiteres Beispiel geben, mit dem Sie vielleicht nur sehr schwer einverstanden sein können. Es geht um den Begriff des „kreativen und des schöpferischen Künstlers.“ Ich möchte kurz erläutern wo dieses Wort „kreativ“ herkommt, um dann zu zeigen, wie wir es heute fast immer falsch verwenden. Mir scheint dies wichtig, weil dieses Wort vom kreativen Künstler öfters im Kunstjournalismus vorkommt und falsch verwendet wird.
Das Wort „kreativ“, bezogen auf künstlerisches Schaffen hat zum ersten Mal der Philosoph Nicolaus von Cues, genannt Cusanus (1401 - 1464) am Beginn der Neuzeit in seinem Werk „De Docta Ignorantia“ (Über die gelehrte Unwissenheit) verwendet. Er nahm eine Unterscheidung vor von Mikrokosmus und Makrokosmos, die er von dem griechischen Philosoph Plato übernahm: die Welt als die große Schöpfung und die Welt im Kleinen. So wie Gott, der „Creator“, die Welt als Ganzes geschaffen hat, soll nun der Mensch als Künstler, irdisch begrenzt neue Welten im Kleinen schaffen, nämlich durch das Kunstwerk. Dadurch, dass nun der Mensch schöpferisch tätig wird, erfüllt er seine Gottesebenbildlichkeit. Kreativ sein heißt analog zu Gottes Handeln, so wie Gott im Großen, so musst die Künstlerin, der Künstler die Welt im Kleinen machen. Diese Analogie ist ursprünglich als „Kreativ“ verstanden worden und so ist von der Tradition her – von der wir leider zunehmend abgetrennt sind – das Wort kreativ auch sinnvoll. Wenn jemand heute sagt er sei schöpferisch tätig, dann hat er nicht vor, wie Gott/das Heilige zu wirken. Künstler stellen heute zunehmend selten Werke her, die eine ganze bewegte Welt in sich zeigen. Darum bemühe ich mich in meiner Kunstpraxis, natürlich nicht immer mit Erfolg. Dieses Bestreben fehlt mir aber oft bei meinen Kollegen und im Kunstbetrieb. Das der Künstler derjenige ist, der etwas Ähnliches verfertigt wie ein Gott als Kreator, ist kaum noch zu erwarten. Viel besser wäre es zu sagen: „ein Künstler produziert.“ Das klingt nicht so chic, es wäre aber richtiger. Übrigens: der richtige Begriff für praktisches und theoretisches Handeln stammt aus dem Altgriechischen und heisst „poiesis“ = selbstschöpferisch Handeln.
Wir gaben Ihnen Beispiele aus der Kunstphilosophie, um Ihnen eine gewisse Grundlage zu geben, Texte des Kulturjournalismus kritischer einschätzen zu können. Im nächsten und letzten Essay zu diesem Thema werden wir ein paar Beispiele aus den Schweizer Zeitungen (vorwiegend die NZZ) diskutieren und beleuchten. Ich hoffe nach dem Lesen dieser Zeilen sind Sie dann auch in der Lage, Texte über Kunst besser einzuschätzen und ernster nehmen zu können. Natürlich freue ich mich wie immer, um Ihr Feedback – oder Besuch bei mir im Atelier um das hier Geschriebene zu diskutieren.
Einer, welcher zur Ästhetik und Geschichte der Medien hervorragende Forschung leistete, ist der Basler Kunsthistoriker Beat Wyss (1947 geb.). Mit einem Zitat aus seinem Buch: „Die Welt als T-Shirt“ (1997, Verlag Dumont, Köln) möchte ich diesen zweiten Teil beenden.
„Die Idealisierung des Künstlers zu einem „edlen Wilden“ wertet dessen Tätigkeit ab zu schamanistischer Folklore. Die Kunst fährt damit in die musische Sackgasse mit Dilettantentum und Bricolage. Das Hochhalten der – angeblich – schöpferischen Individualität und Primitivität ist entweder naive Überschätzung künstlerischer Inkompetenz oder zynisches Kalkül mit der Inkompetenz des Kunstbetrachters, es erlaubt die Plünderung des avantgardistischen Formenguts ohne die Kenntnis von dessen ideellen Einzelgebeiten. Ohne den geistigen Hintergrund der klassischen Moderne jedoch verkommt Kunst zur Maltherapie und musischer Pädagogik. Das basteln auf eigener Kosten mit den visuellen Abfällen der Zivilisation bringt keinen Erkenntnisgewinn mehr. Nicht jeder Mensch ist ein Künstler! Die Konkurrenz der Massenmedien ist zu erdrückend, als das die Kunst der Dilettantenmagie kreativen Handauflegens überlassen werden kann. Dem Kunstberuf und dessen Ausbildung sollte heute wieder das hohe technische und intellektuelle Profil der Renaissance zurück gegeben werden.“
© Martin Rabe & Sibylle Laubscher
Weitere Texte
-
![Vibrations of being: The Art of Resonant Spaces]()
![Vibrations of being: The Art of Resonant Spaces]()
Vibrations of being: The Art of Resonant Spaces
-
![Ansprache an der Ausstellung zur Frauenfussball EM in Sion, Schwiez, 2025]()
![Ansprache an der Ausstellung zur Frauenfussball EM in Sion, Schwiez, 2025]()
Ansprache an der Ausstellung zur Frauenfussball EM in Sion, Schwiez, 2025
-
![Speech opening the art exhibition celebrating the Women's Football Championships, Switzerland 2025]()
![Speech opening the art exhibition celebrating the Women's Football Championships, Switzerland 2025]()
Speech opening the art exhibition celebrating the Women's Football Championships, Switzerland 2025
-
![Ist Kunst lehrbar? Teil I]()
![Ist Kunst lehrbar? Teil I]()
Ist Kunst lehrbar? Teil I
-
![Ist Kunst lehrbar? Teil II]()
![Ist Kunst lehrbar? Teil II]()
Ist Kunst lehrbar? Teil II
-
![Can Art be taught?]()
![Can Art be taught?]()
Can Art be taught?
-
![Ist Kunst lehrbar? | Teil III]()
![Ist Kunst lehrbar? | Teil III]()
Ist Kunst lehrbar? | Teil III
-
![Can Art be taught | Part III]()
![Can Art be taught | Part III]()
Can Art be taught | Part III
-
![Statt einer Vernissagerede – ein Dialog über Kunst]()
![Statt einer Vernissagerede – ein Dialog über Kunst]()
Statt einer Vernissagerede – ein Dialog über Kunst
-
![Instead of a vernissage speech – a dialog about art]()
![Instead of a vernissage speech – a dialog about art]()
Instead of a vernissage speech – a dialog about art
-
![Schaffen Einschränkungen eingeschränkte Kunst?]()
![Schaffen Einschränkungen eingeschränkte Kunst?]()
Schaffen Einschränkungen eingeschränkte Kunst?
-
![Do restrictions create limited art?]()
![Do restrictions create limited art?]()
Do restrictions create limited art?
-
![Die Krise der Wissenschaften und der Künste]()
![Die Krise der Wissenschaften und der Künste]()
Die Krise der Wissenschaften und der Künste
-
![The crisis in science and art]()
![The crisis in science and art]()
The crisis in science and art
-
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil 1]()
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil 1]()
Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil 1
-
![Artificial Intelligence & the Absurd Part 1]()
![Artificial Intelligence & the Absurd Part 1]()
Artificial Intelligence & the Absurd Part 1
-
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil II]()
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil II]()
Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil II
-
![Artificial Intelligence & the Absurd Part II]()
![Artificial Intelligence & the Absurd Part II]()
Artificial Intelligence & the Absurd Part II
-
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil III]()
![Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil III]()
Künstliche Intelligenz & das Absurde Teil III
-
![Artificial Intelligence & the Absurd Part III]()
![Artificial Intelligence & the Absurd Part III]()
Artificial Intelligence & the Absurd Part III
-
![Künstliche Intelligenz und das Absurde Teil IV (Schluss)]()
![Künstliche Intelligenz und das Absurde Teil IV (Schluss)]()
Künstliche Intelligenz und das Absurde Teil IV (Schluss)
-
![Artificial Intelligence and the Absurd Part IV (Conclusion)]()
![Artificial Intelligence and the Absurd Part IV (Conclusion)]()
Artificial Intelligence and the Absurd Part IV (Conclusion)
-
![Why are Americans/the Swiss afraid of Dragons? by Ursula Le Guin]()
![Why are Americans/the Swiss afraid of Dragons? by Ursula Le Guin]()
Why are Americans/the Swiss afraid of Dragons? by Ursula Le Guin
-
![Warum haben Amerikaner/Schweizer Angst vor Drachen? von Ursula Le Guin]()
![Warum haben Amerikaner/Schweizer Angst vor Drachen? von Ursula Le Guin]()
Warum haben Amerikaner/Schweizer Angst vor Drachen? von Ursula Le Guin